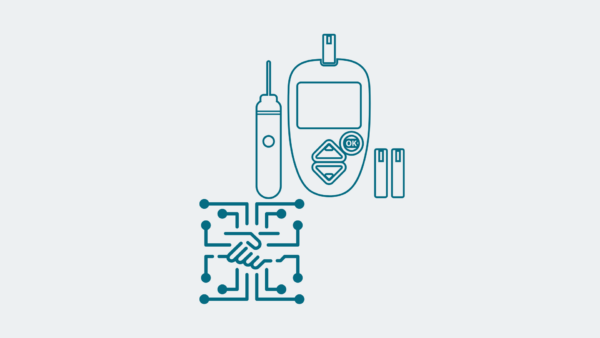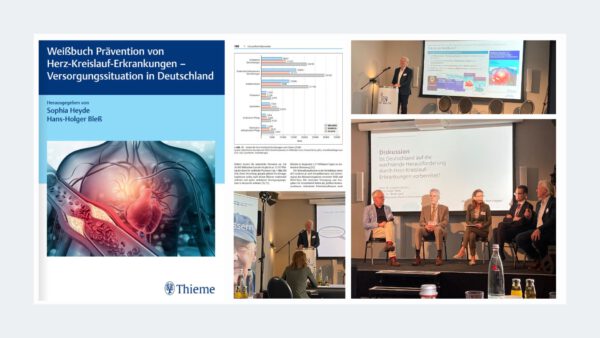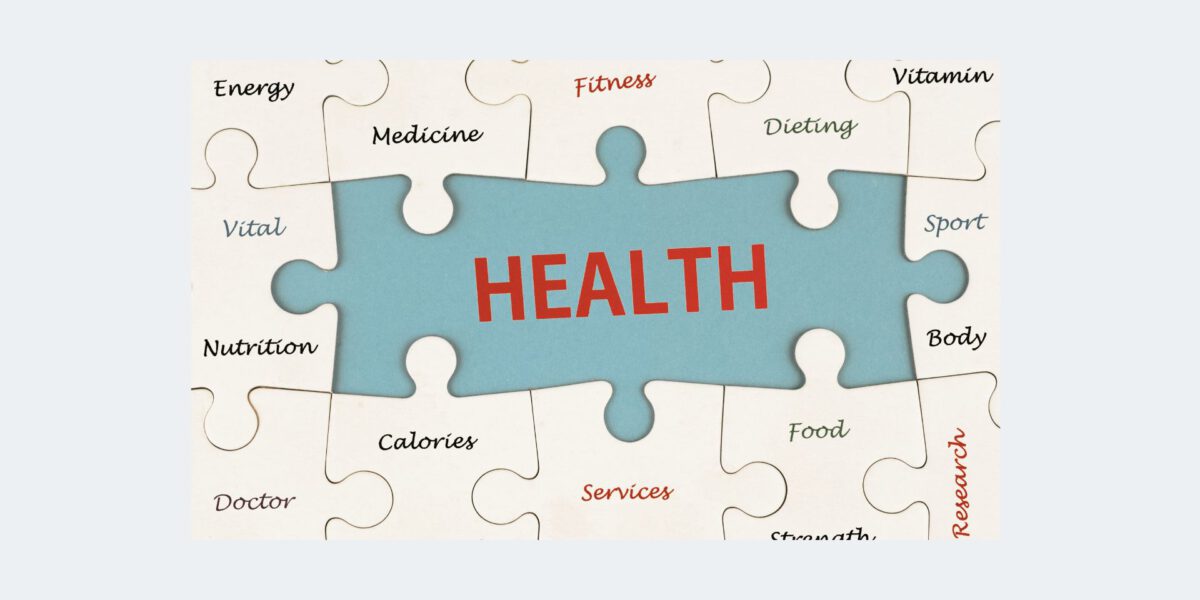
Mit ihrer Präsenz auf dem Kongress für Prävention und Longevity der Gesundheitsstadt Berlin hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken ein deutliches Zeichen gesetzt: Prävention rückt ins Zentrum gesundheitspolitischer Aufmerksamkeit und mit dem geplanten Institut für Prävention und Gesundheitskommunikation sind konkrete Schritte in Planung.
Es ist ein notwendiges Signal – eines, dem strukturelle Umsetzung folgen muss. Denn die Frage ist längst nicht mehr, ob Prävention sinnvoll ist, sondern: Warum ist sie – insbesondere im Bereich der Sekundärprävention – noch immer nicht systematisch verankert?
Prävention funktioniert. Aber noch nicht ausreichend im deutschen System
Chronische Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Leiden oder bestimmte Krebsarten entstehen meist nicht plötzlich. Sie entwickeln sich über Jahre – und oft entlang klarer Risikoprofile. Genau hier setzt Sekundärprävention an: bei den Menschen, die schon erste Warnzeichen zeigen, aber noch nicht erkrankt sind.
Die wissenschaftliche Evidenz ist eindeutig:
- 40 % der Prädiabetiker:innen können durch Lebensstilinterventionen in die Remission geführt werden (Sandforth et al., 2023).
- Rund 50 % bestimmter Krebserkrankungen gelten als vermeidbar (DKFZ, 2021).
- Programme wie das US-amerikanische DPP oder das NHS DPP in Großbritannien belegen: Prävention wirkt – medizinisch wie ökonomisch.
Doch obwohl die Evidenz zu Lebensstilinterventionen und chronischer Krankheitsvermeidung eindeutig ist und die nationalen Versorgungsleitlinien dazu diese sekundärpräventive Interventionen auch klar adressieren, bleibt die praktische Integration in die Regelversorgung in Deutschland bislang unzureichend.
Sekundärprävention: Der blinde Fleck der Versorgung
Während Primärprävention öffentlich gefördert wird – in Schulen, Betrieben oder über Bonusprogramme – bleibt die gezielte Vorsorge für Risikogruppen ein struktureller Leerraum und der vielleicht wirksamste Hebel bleibt systemisch unterentwickelt: die Sekundärprävention. Sie richtet sich an Menschen, bei denen erste Risikofaktoren oder Vorstufen chronischer Krankheiten bereits bestehen – etwa Prädiabetes, metabolisches Syndrom, Bluthochdruck. Genau hier könnte Versorgung gezielt, effektiv und ressourcenschonend eingreifen.
Doch bislang fehlen:
- Verbindliche Verankerung in der Regelversorgung über Leitlinien
- Sektorenübergreifende Steuerung
- Breiter Zugang jenseits von Einzelprojekten und DMPs
- Anreizsysteme (bspw. eine Vergütung, die Wirkung belohnt statt Leistungsmengen)
Das geplante Institut für Prävention und Gesundheitskommunikation kann wichtige Impulse setzen, doch ohne strukturelle Steuerung, Finanzierung und Umsetzungskonzept läuft es Gefahr, nur Symbolpolitik zu bleiben. Es sollte den Umbau des Systems zu einem GESUNDHEITssystem mit einem präventiven Fokus richtungsgebend begleiten.
Modellprojekte zeigen, wie es gehen kann
Wie eine konkrete Umsetzung aussehen und ein Setting geschaffen werden kann, um Prävention zum Gamechanger zu machen, zeigen verschiedene Modellprojekte auf: Sowohl regional, auf Populationen ausgerichtete als auch erkrankungsbezogen können Gesundheitsökosysteme performanter werden. Dies kann z. B. in Gesundheitsregionen oder in Versorgungsnetzwerken zur stationären oder Primärversorgung erfolgen.
Der Ansatz: Prävention als strategischer Bestandteil einer regionalen, digital unterstützten, hybriden und sektorenübergreifenden Versorgungsstruktur:
- Integration von Versorgungs- und Strukturplanung
- Digitale, datengestützte Analyse regionaler Versorgungspotenziale
- Entwicklung konkreter, umsetzbarer Maßnahmenpläne
- Beteiligung von Kommunen, Versorgungseinrichtungen, Kassen und KVen
Ziel ist eine hybride, sektorenübergreifende Versorgungsstruktur, die Prävention nicht ergänzt, sondern mit plant – entlang von Lebensphasen und Versorgungspfaden.
Mit der Ankündigung des neuen Instituts setzt das BMG ein sichtbares Zeichen. Jetzt kommt es darauf an, dass daraus mehr wird als ein Impuls in der Kommunikation. Sekundärprävention funktioniert. Die Evidenz ist vorhanden. Die Konzepte existieren. Jetzt braucht es eine Struktur, die die trägt.
_fbeta begleitet Gesundheitsakteure dabei, Prävention systemisch zu verankern – mit regionaler Steuerung, datenbasierten Analysen und praxiserprobten Umsetzungsmodellen. Sprechen Sie uns an.
Ansprechpartner